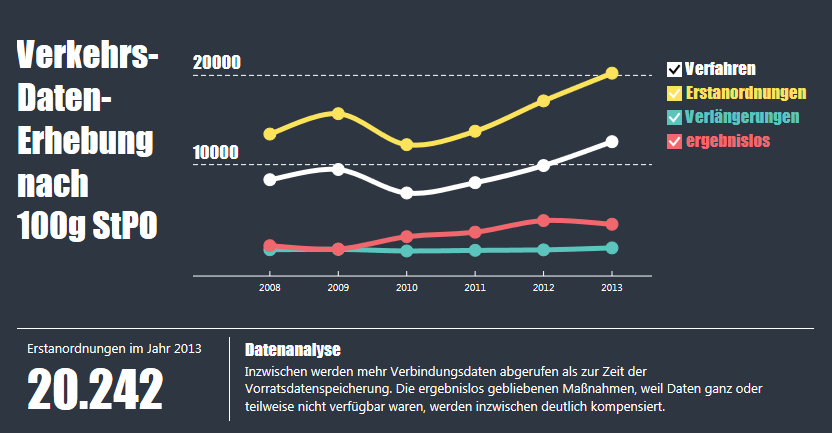24 Tage lang protokollierte die britische Tageszeitung The Guardian auf ihrer Website, was die New York Times, Der Spiegel, Le Monde, El País und sie selbst über die 251.000 Depeschen des US-Außenministeriums veröffentlichten. Am 22. Dezember schließlich der letzte Eintrag, der unter anderem auf ein Interview des Spiegel mit Bundesinnenminister Thomas de Maizière hinwies, der WikiLeaks als „ärgerlich, aber keine Bedrohung“ bezeichnete. Einen Tag zuvor hatte US-Vize-Präsident Joe Biden WikiLeaks-Chef Julian Assange noch als „Hightech-Terrorist“ bezeichnet.
Eine Auswertung dieser Chronologie zeigt, dass der Guardian mit Abstand das Meiste aus den Depeschen machte: Er veröffentlichte in den ersten 24 Tagen 158 Artikel, das sind 7 Artikel täglich. Etwa auf einer Augenhöhe befinden sich der Spiegel mit 30 Beiträgen, dieNew York Times mit 32 Beiträgen und El País mit 33 Beiträgen und etwa 1,4 Artikeln pro Tag im Schnitt. Deutliches Schlusslicht ist Le Monde mit 23 Beiträgen – mit gerundet etwa einem Beitrag täglich. Allerdings sind etliche Artikel des Spiegel dabei nicht berücksichtigt. Nach Auskunft des Spiegel-Sprechers Hans Ulrich Stoldt veröffentlichte der Spiegel im Heft,online sowie in einer Spiegel-Special-Ausgabe insgesamt 143 Beiträge in diesem Zeitraum. Damit ist der Guardian aber immer noch unangefochtener Spitzenreiter.
Die meisten Beiträge wurden in der ersten Woche veröffentlicht, in der zweiten Woche ging die Frequenz zurück, in der Woche vor Weihnachten stellten einige Redaktionen die Berichterstattung ganz ein. Der Spiegel veröffentlichte laut der Zählung des Guardian nur noch eine einzige Geschichte. Von Weihnachten bis zum 18.1. veröffentlichte er nach Angaben von Stoldt nur noch weitere fünf Beiträge. Eine Planung, in welchem Tempo weiterhin veröffentlicht werden soll, gebe es nicht.
Keine Auswertung gibt es darüber, in welchem Ausmaß diese Berichte von anderen Medien aufgegriffen und weiter recherchiert wurden. Vielleicht eine Aufgabe für künftige Journalistik-Studien. Unzählig hingegen sind die Berichte über den Fall des WikiLeaks-Gründers Julian Assange.
Deutlich wird jedenfalls die Führungsrolle des Guardian bei der redaktionellen Auswertung der US-Depeschen. Dies zeigt sich nicht nur an der Menge der bearbeiteten Informationen, sondern auch an der Art, wie diese präsentiert werden: Nämlich möglichst übersichtlich für die Leser – und im Sinne der vom Guardian seit Jahren offensiv propagierten „Open Data“-Philosophie, die bereits zahlreiche aufsehenerregende Datenjournalismus-Projekte inspirierte.
In diesem Zusammenhang ist es auch erwähnenswert, dass der Guardian die Metadaten der WikiLeaks-Cables in einer offenen Datenbank zur Auswertung frei gegeben hat – während etwa der Spiegel die Depeschen lediglich in einer von außen unzugänglichen Flash-Grafik aufbereitet hat. Auf diese Weise entstanden auf Grundlage der Guardian-Daten einige interessante Auswertungen. Unter anderem visualisierte eine Grafik Themenstränge für die Jahre 2001 bis 2003 und zeigt damit den Impact des 11. September auf Amerikas Diplomatie. Gefährdet wird durch die Freigabe der Metadaten niemand, doch nicht nur für Journalisten, sondern auch für Politikwissenschaftler und Historiker können solche Auswertungsmöglichkeiten wertvoll sein.
Exklusive Themenauswahl
Wie gingen die von WikiLeaks bedachten Redaktionen bislang mit den Depeschen um? Auffallend ist, dass sie darauf achteten, eigene Themen zu setzen. Eine Geschichte desGuardian mit Deutschlandbezug, die kurz vor Weihnachten erschien, wurde beispielsweise vom Spiegel nicht aufgegriffen. Darin ging es um das zeitweise Engagement des Energiekonzerns RWE in einem Kernkraftwerkprojekt in Bulgarien, das laut der Depeschen von ständigen Sicherheitsproblemen begleitet war. Für die Briten war es offenbar deshalb eine Geschichte, weil RWE Besitzerin von Großbritanniens größtem Energieversorgernpower ist, der das Projekt durchführte.
Es scheint, als wäre die große Enthüllungswelle erst einmal zum Erliegen gekommen. Seit Weihnachten werden die Depeschen auf der WikiLeaks-Website nur noch tröpfchenweise veröffentlicht. Woran dies liegt, darüber lässt sich spekulieren. Da den Redaktionen alle Depeschen vorliegen, könnte es daran liegen, dass der Sprengstoff der Depeschen schlicht verbraucht ist.
Aftenposten sprengt Kreis der Auserwählten
Dass dies nicht der Fall ist, zeigen die jüngsten Veröffentlichungen der norwegischen Tageszeitung Aftenposten. Sie hat seit Ende Dezember laut eigenen Angaben Zugriff auf alle Dokumente – durch ein Leck innerhalb von WikiLeaks. Offenbar gibt es innerhalb vonWikiLeaks Personen, die die bisherige Veröffentlichungspolitik torpedieren. Von diesem Leck profitierte inzwischen auch Die Welt, die dank einer Kooperation mit Aftenposten seit Mitte Januar ebenfalls „ohne jede Beschränkung“ Zugriff auf alle Depeschen hat.
Die ersten Veröffentlichungen von Aftenposten lösten internationale Resonanz aus. So erläuterten Dokumente der US-Botschaft in Oslo die Verhandlungen zwischen Norwegen und Russland über die gemeinsame Grenze in der Barents-See. Eine AFP-Meldung griff einen weiteren Aftenposten-Bericht auf, wonach Deutschland und die USA für rund 205 Millionen Euro gemeinsam ein hochauflösendes Satellitensystem unter dem Projektnamen HiROS gegen Widerstände aus Frankreich entwickeln wollten. Dieser Satellit soll unter der Kontrolle des Bundesnachrichtendienstes und des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) stehen. Etliche Tage später berichtete auch Spiegel Online über das Projekt – und dass die Bundesregierung es nicht unterstützen wolle. Dabei wurde die entsprechende Depesche weder verlinkt, noch wurde der Bericht von Aftenposten erwähnt.
Die Redaktionen scheinen mit den Depeschen mit einer nahe liegenden Methode umzugehen: Sie recherchieren die Themen, die sie kennen. Werden sie fündig und erscheint das Material interessant genug, berichten sie darüber. Es ist offensichtlich, dass auf diese Weise noch längst nicht alles publiziert wurde, was Nachrichtenwert besitzt. Die bislang veröffentlichten Geschichten reflektieren damit vermutlich vor allem die aktuelle Interessenlage und Themenkompetenz der jeweiligen Redaktion.
Exklusivvertrag mit WikiLeaks?
Aftenposten gehört nicht zu dem erlauchten Kreis der vier großen Publikationen (Guardian,Le Monde, El País und Spiegel), die mit WikiLeaks die Veröffentlichung vereinbart hatten. Die New York Times selbst hat die Dokumente vom Guardian bekommen. Aftenposten-Redaktionsleiter Ole Erik Almlid sagte laut der Nachrichtenagentur dapd: „Wir haben diese Dokumente ohne Auflagen und ohne etwas dafür zu bezahlen bekommen“. Die Zeitung werde die ihr wichtig erscheinenden Depeschen veröffentlichen und unter Umständen heikle Informationen wie Namen unkenntlich machen.
Die Äußerung von Almlid wirft aber auch ein interessantes Licht auf die mutmaßliche Vereinbarung zwischen WikiLeaks und den vier Redaktionen. Spiegel-Sprecher-Stoldt jedenfalls sagt: „Es gibt keinerlei Vereinbarungen mit WikiLeaks. Ausnahme: Der Termin zur ersten Veröffentlichung der Depeschen war mit WikiLeaks und den anderen Medienpartnern abgesprochen.“ Der US-Fernsehsender CNN und das Wallstreet-Journalhatten nach eigenen Angaben eine Zusammenarbeit jedoch abgelehnt, da sie nicht bereit waren, die von WikiLeaks geforderten Vertragsklauseln zu unterzeichnen. Diese sollen unter anderem eine nicht mit WikiLeaks abgestimmte Publikation verbieten. Außerdem ist die Rede von einer Vertragsstrafe von 100.000 Dollar bei Zuwiderhandlung.
Ob eine mindestens mündlich getroffene Vereinbarung zwischen den Verlagen und der Enthüllungsplattform presserechtlich ebenfalls als Exklusivvertrag zu werten ist, darüber wird der Presserat im März entscheiden müssen. Im Falle des Spiegel geht es immerhin um einen exklusiven Zugang innerhalb des deutschsprachigen Raums. Nach Ansicht der Beschwerdeführerin verstößt der Spiegel gegen die Richtlinie 1.1. des Pressekodex. Sie untersagt Exklusivverträge mit Informanten über „Vorgänge oder Ereignisse, die für die Meinungs- und Willensbildung wesentlich sind“. Weiter heißt es: „Wer ein Informationsmonopol anstrebt, schließt die übrige Presse von der Beschaffung von Nachrichten dieser Bedeutung aus und behindert damit die Informationsfreiheit.“
Eine Frage der Masse
Das Besondere an den WikiLeaks-Depeschen ist ganz offensichtlich die schiere Masse: Um sie auswerten zu können, muss eine Redaktion nicht nur über genügend Manpower und Know-How verfügen. Sie sollte auch in der Lage sein, mit anderen journalistischen Organisationen vertrauensvoll zu kooperieren. Trotz des angeblich fehlenden Vertrags ist der Spiegel dazu aber anders als die Aftenposten nicht bereit. Stoldt zu dieser Frage: „Es sind keine Kooperationen mit anderen Redaktionen vorgesehen.“ Aus Sicht der Journalisten als Protagonisten der Meinungs- und Pressefreiheit muss das Hauptinteresse darin bestehen, die Informationen einzuordnen, zu bewerten – und dann erst Öffentlichkeit bei einem Optimum an Transparenz herzustellen. Aus Sicht der Whistleblower muss der Informantenschutz gewahrt – und eine größtmögliche Öffentlichkeitswirkung erzielt werden.
Weil in den Datennetzen von Behörden und Unternehmen immer mehr Dokumente gespeichert werden, werden künftig immer wieder Whistleblower massenhaft Daten an die Öffentlichkeit bringen wollen. Für Journalisten ist das sowohl Anlass zur Freude als auch zur Sorge. Einerseits erhält man brisantes Material für aufsehenerregende Geschichten. Andererseits müssen die Dokumente wie andere auch auf Authentizität und Echtheit überprüft werden. Außerdem müssen Sicherheitsmaßnahmen ergriffen werden, um die Informanten samt Material zu schützen. Eine Aufgabe, der sicherlich nicht jeder Journalist und auch nicht jede Redaktion gewachsen ist.
Auch muss eine Redaktion sich mit der Frage auseinandersetzen, wie weit das eigene Veröffentlichungsinteresse tatsächlich geht. Die Masse der Dokumente reicht aus, um die Berichterstattung auf Jahre hinaus zu versorgen. Doch darauf wird sich kein Verlag einlassen, da es immer auch konkurrierende Themen gibt, die möglicherweise von größerer Relevanz sind. Im Ergebnis sind die Archive der jeweiligen Redaktionen um eine wertvolle zusätzliche Quelle erweitert. Im Sinne einer informierten Öffentlichkeit stellt sich jedoch die Frage, ob eine Privatisierung dieses Informationsschatzes richtig ist. Auf dies würde es nämlich hinauslaufen, wenn WikiLeaks das aktuelle Veröffentlichungstempo beibehält – und dies stünde der ursprünglichen Intention der Whistleblower-Plattform entgegen.
Ganz offenbar müssen Journalisten und Whistleblower neue Prozeduren entwickeln, um verantwortlich mit dem Material umzugehen. Einerseits müssen sie Informanten schützen, andererseits müssen sie so viele Informationen wie möglich strukturiert veröffentlichen. Dabei müssen sie viele, sich widerstreitende Interessen austarieren.
Nüchtern betrachtet besteht das Neue an WikiLeaks vor allem in der Masse der Veröffentlichungen, ihrem weltweiten Erfolg und darin, der Weltöffentlichkeit einen tragischen Helden zu liefern. Seit Jahrzehnten gibt es nämlich schon die WebsiteCryptome.org des New Yorker Architekten John Young, die ebenfalls vertrauliche Dokumente aus aller Welt im Internet veröffentlicht. Er musste ebenfalls bereits mehrere Gerichtsprozesse durchstehen – erfolgreich. Denn die Presse- und Meinungsfreiheit werden in den USA von den Gerichten so hoch bewertet, dass John Young bislang immer durchkam.
Ob ein Prozess gegen WikiLeaks in den USA erfolgreich sein wird, ist zweifelhaft. Man müsste Assange schon nachweisen, dass er den verhafteten Whistleblower Bradley Manning zum „Verrat“ von Staatsgeheimnissen anstiftete. Dies würde dann in die Kategorie „Spionage“ fallen, was zu ahnden wäre. Dafür könnte es genügen, Manning zu einer entsprechenden Aussage zu bringen. Assange äußerte selbst diese Vermutung gegenüber dem britischen Nachrichtenmagazin New Statesman: „Bradley Manning zu knacken, ist nur der erste Schritt. Ganz offensichtlich ist es das Ziel, ihn zu brechen und ein Geständnis zu erzwingen, dass er sich in irgendeiner Weise mit mir verschworen hat, um die nationale Sicherheit der USA zu verletzen.“
Nächste Schritte
Immer wieder betonten die Macher von WikiLeaks, dass ihre Technik so ausgestaltet ist, dass die Identitäten der Whistleblower gegenüber der Plattform unbekannt bleiben. Anonymität ist damit nicht nur ein Schutz der Quelle, sondern auch automatisch ein rechtlicher Schutz für die Empfänger.
Angesichts des unbestreitbaren Erfolgs der Plattform ist es erstaunlich, dass es im Zeitalter innovativer Zeitungsausgaben für das mobile Internet nicht schon längst auf allen Verlagswebsites anonyme digitale Briefkästen für Informanten gibt. Die Technik dafür gibt es nicht erst seit heute. Schon seit etwa zehn Jahren unterstützen etwa das Kryptoprogramm „Pretty Good Privacy“ und das Anonymisierungstool JAP kostenlos die sichere und anonyme Kommunikation. Dass ehemalige WikiLeaks-Mitarbeiter nun mitOpenLeaks ein handliches Tool für Whistleblower anbieten wollen, das dies aus einer Hand bietet, ist überfällig. Diese Initiative hätte aber auch von professionell-journalistischer Seite kommen können.
Ein weiterer nächster Schritt könnte darin bestehen, sich in Deutschland für die rechtliche Absicherung von Informanten einzusetzen. Einen gesetzlichen Whistleblower-Schutz gibt es nämlich bis heute nicht.
Erschienen in der Ausgabe 1/2-2011 der M